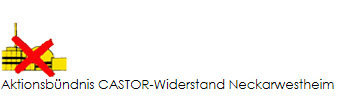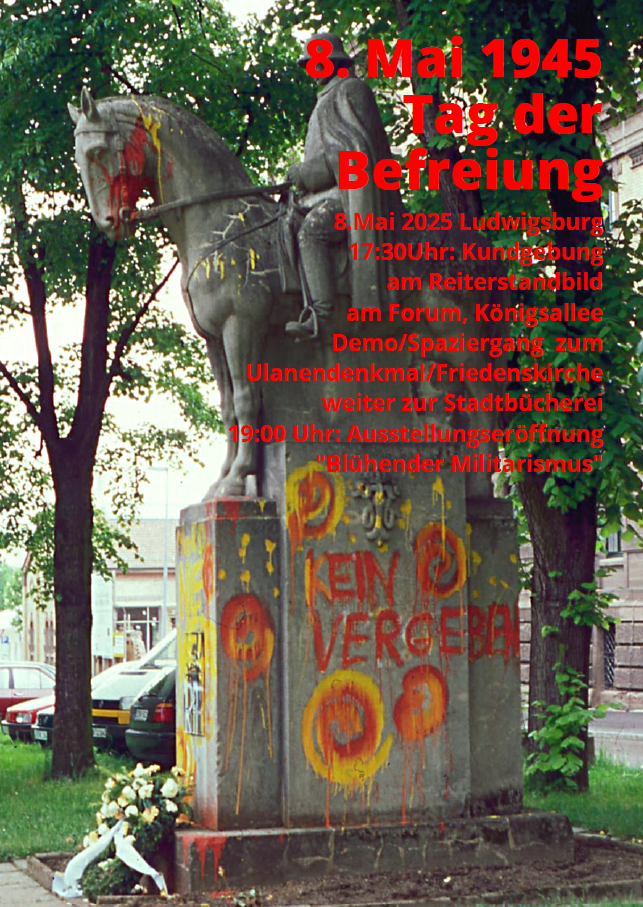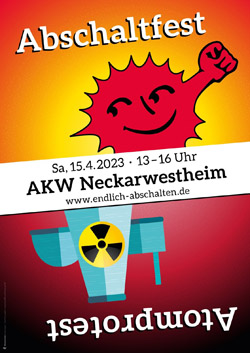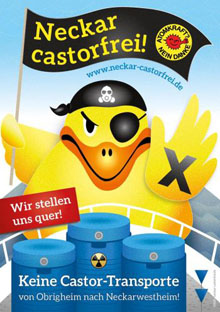Positionspapiere des Bündnis Bürgerenergie e.V.
 Zur Frage der weiteren Schritte und der Struktur einer dezentralen und umweltfreundlichen Energiewende stellten wir Euch im Newsletter vom 23.04. in Auszügen zwei Positionspapiere des Bündnis Büergerenergie e.V. vor. Diese entstanden als Antwort auf ein von Habecks Wirtschaftsministerium (BMWK) vorgelegtem Optionspapier für ein zukünftiges Strommarktdesign und beinhalten wesentliche Aspekte einer positiven Energiewende.
Zur Frage der weiteren Schritte und der Struktur einer dezentralen und umweltfreundlichen Energiewende stellten wir Euch im Newsletter vom 23.04. in Auszügen zwei Positionspapiere des Bündnis Büergerenergie e.V. vor. Diese entstanden als Antwort auf ein von Habecks Wirtschaftsministerium (BMWK) vorgelegtem Optionspapier für ein zukünftiges Strommarktdesign und beinhalten wesentliche Aspekte einer positiven Energiewende.
Aus diesen beiden Positionspapiere haben wir die nachfolgenden Texte entnommen.
1. Positionspapier:
Optionen für ein sicheres, bezahlbares und nachhaltiges Stromsystem
Das Optionenpapier des BMWK stellt sachkundig und nachvollziehbar mögliche Entwicklungspfade des Energiesystems hin zu einem Stromsystem mit sehr hohen Anteilen erneuerbarer Energien dar und schafft damit die Grundlage für die politische und gesellschaftliche Diskussion. Allerdings lässt das Papier die Perspektive der in der Energieversorgung aktiven Bürger*innen vollständig vermissen. Kriterien wie Klimaneutralität, Verteilungsgerechtigkeit, Akzeptanz und Teilhabe werden dagegen nicht erwähnt, geschweige denn zur Bewertung von Maßnahmen herangezogen.
Wo ist die Teilhabe?
Teilhabe bzw. Partizipation als Schlüsselbegriffe für die Bürgerenergie tauchen im Optionenpapier nicht auf, das Wort Akzeptanz kommt im Optionenpapier genau zwei Mal vor. Bürger*innen werden lediglich ein Mal im Zusammenhang mit Versorgungssicherheit und Preisstabilität erwähnt. Damit behandelt das Optionenpapier den Energiemarkt letztlich als ein volkswirtschaftlich-technisches Phänomen, in dem abgesehen von binären Investment- bzw. Kaufentscheidungen menschliches Handeln keine relevante Größe darstellt.
Ein Energieversorgungssystem ist aber immer ein soziotechnisches System. Die Organisation der technischen Einrichtungen zur Deckung der energetischen Bedarfe – hier Windräder, Solarmodule, Netze, Steuerungsboxen, Speicher etc. – ist nicht von den Menschen, ihren Handlungen, normativen Leitlinien und Interessen zu trennen.
Im erneuerbaren Energiesystem gibt es das neue Phänomen, dass die Menschen als Produzent*innen ihrer eigenen Energiebedarfe – als Prosument*innen – auftreten. Die Energietechnologien rücken immer weiter in das Lebensumfeld der Menschen. Die Menschen werden – z.B. als Flächeneigner*innen oder Investor*innen – zu Protagonisten der Energieversorgung. Damit bekommen Planungssicherheit, Lokalität und Flexibilität einen Stellenwert, dem das Papier allerdings nicht gerecht wird. Energiepolitik ist nicht allein eine Frage der Expert:innen, sondern hat weitreichende Auswirkungen in die Lebenswelt und das Gerechtigkeitsgefühl der Menschen hinein. Dies darf Politik, dies darf das BMWK nicht ignorieren.
Der Energiemarkt muss dem Zweck dienen, nicht die EE dem Markt
Märkte fallen nicht vom Himmel, sie werden von Menschen durch Regulierung erst geschaffen. Leitgedanke der EE-Strommarktreformen ist seit Jahren die Idee der „Strommarktintegration der EE“. Integration in einen bestehenden Markt ist jedoch aus unserer Sicht nur dann sinnvoll, wenn das bestehende System dauerhaft erhalten bleiben soll. Warum sollen die dezentralen erneuerbaren Energien in das bestehende System integriert werden, wenn das bestehende fossil-zentrale System des Strommarkts ein Auslaufmodell ist?
Vielmehr muss es aus unserer Sicht um die Entwicklung eines Marktdesigns für die EE gehen, das die breite Partizipation der Bürger*innen gewährleistet und den konsequenten Weg zur Klimaneutralität beschreitet.
Fadenriss beim EE-Ausbau ist eine reale Option. Im Rückblick haben grundlegende Veränderungen am komplexen Fördersystem der Erneuerbaren Energien immer zu großer Marktunsicherheit geführt. Hieraus sollte die Lehre gezogen werden, das Fördersystem nur behutsam und wenn notwendig zu verändern.
Negativpreisphasen an der Strombörse
Minimalinvasive Lösungsvorschläge werden nicht geprüft. Generell verwundert es, wie das BMWK durch einen kompletten Systemwechsel beim EE-Fördermechanismus das Kind mit dem Bade auszuschütten droht. Denn für das Problem der Negativpreisphasen an der Börse liegen bei gründlicher Analyse der Ursachen eine Vielzahl von Vorschlägen auf dem Tisch. Hierzu gehören der Abbau inflexibler fossiler Must-Run-Kapazitäten ebenso wie die Berücksichtigung von Wärmespeichern, aber auch die Effekte eines höheren CO2-Preises auf die Merit-Order, die Strompreise und damit auf den Förderbedarf.
Zudem werden Vorschläge, zum Beispiel die gleitende Marktprämie von einer Zeit- auf eine Mengenorientierung umzustellen, nicht hinreichend diskutiert. Hierdurch entsteht der Eindruck, dass ohne Not eine Systemumstellung als notwendig dargestellt wird, deren Folgen mit großen Unsicherheiten verbunden ist. Beim Kapazitätsmechanismus bleibt Klimaneutralität außen vor.
Thema Versorgungssicherheit
Ursprünglicher Ansatz der Bundesregierung war hierbei zunächst die Kraftwerksstrategie, nach der 25 GW neuer, steuerbarer, möglichst mit H2 betriebener Kraftwerke ausgeschrieben werden sollten. Stand heute sind „lediglich“ 12,5 GW an neuen oder ertüchtigten Wärmekraftwerken geplant.
Beim favorisierten kombinierten Modell bleibt unklar, ab wann H2 als Brennstoff für alle 12 GW eingesetzt wird. Es wird nur allgemein auf den Emissionshandel verwiesen. In der Zwischenzeit werden den großen Kraftwerksbetreibern die Investkosten für Kraftwerke in der Größe eines Drittels des bestehenden Gaskraftwerkparks in Deutschland (2024: 36 GW) mit öffentlichen Mitteln finanziert, während fast ausschließlich fossiles Erdgas weiterhin die Klimakrise verschärfen wird.
Aller Voraussicht nach werden durch großzügige Planung zugunsten finanzstarker Konzerne (weitgehend fossil betriebene) (Über-)kapazitäten geschaffen, welche die Entwicklung innovativer Flexibilitätslösungen erschweren. Wir sind deshalb der Ansicht, dass ein Klimaneutralität anstrebender Kapazitätsmechanismus der Nutzung von Gas klare Grenzen setzen muss.
2. Positionspapier:
Energy Sharing für die Bürgerenergie
Die Transformation unseres Energiesystems ist dann erfolgreich, wenn die Menschen mitbestimmen, mitverdienen und mitmachen können. Das stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt, macht unsere Demokratie krisenfester und schafft Einkommen und Einnahmen für Bürger*innen und Kommunen.
Energy Sharing für die Bürgerenergie ist dafür ein unentbehrliches Instrument.
- denn die Teilhabe der Bürger*innen fördert die gesellschaftliche Akzeptanz und Beteiligung am Umbau des Energiesystems;
- stellt die lokale Wertschöpfung und die gerechtere Verteilung dieser sicher;
- steigert das Interesse am Bau von EE-Anlagen und mobilisiert damit private wie öffentliche Investitionen;
- schafft Anreize, den Stromverbrauch an die Erzeugung der gemeinschaftlich genutzten Anlagen auszurichten;
-erzeugt marktlich, volkswirtschaftlich wie auch netztechnisch positive Effekte und kann dazu beitragen, schneller mehr erneuerbare Erzeugung und mehr neue, flexible Stromverbraucher in das bestehende Stromnetz zu integrieren;
- kann durch die Regionalisierung von Stromerzeugung und -verbrauch dazu beitragen, dass weniger Energie-Infrastruktur benötigt und somit ein positiver Beitrag zum Naturschutz erzielt wird;
- bringt die Demokratieförderung im Energiesystem voran.
Die Europäische Union hat das Potential von Energy in Bürgerenergiegesellschaften (BEGen) erkannt und bereits 2019 in Art. 22 der Erneuerbare Energien-Richtlinie (RED II) mit einer Umsetzungsfrist bis Mitte 2021 verankert. Die Frist lief ohne entsprechende Umsetzung in deutsches Recht Sharing ab. Die Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie (EMD), die im April 2024 vom Europäischen Parlament beschlossen wurde, spezifiziert zentrale Aspekte des Energy Sharing und weitet das Recht auf Energy Sharing aus auf alle aktiven Kund*innen.
Energy Sharing ermöglicht bei richtiger Ausgestaltung, dass Bürger*innen nicht mehr nur Erneuerbare-Energien-Anlagen gemeinsam betreiben, sondern den Strom ihrer Anlagen auch gemeinsam nutzen können. Die Einbindung von Wind- und PV-Parks, großen PV-Dachanlagen sowie Energiespeichern in Energy Sharing-Konzepte dient der gemeinsamen Nutzung von Energie, die von einer Anlage erzeugt wird, welche sich im kollektiven Besitz der Verbraucher*innen befindet oder von diesen gepachtet oder gemietet wurde. Zielsetzung ist die Einbindung von Wind- und Solarparks, bei denen die Akzeptanz oft eine Herausforderung ist.